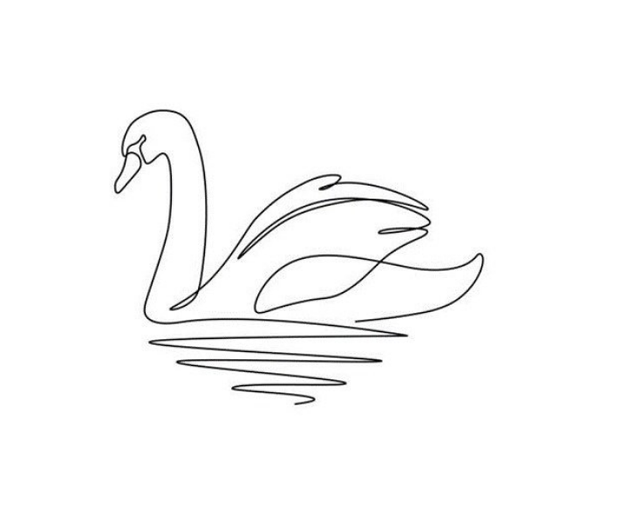Abgeschlossene Forschungsstudien
DESTINY
Depression and Stimulation in Youth - Transcranial direct current stimulation in the treatment of juvenile depression in a naturalistic inpatient setting: A double-blind randomized controlled feasibility trial
Depression ist eine der häufigsten psychischen Erkrankungen in der gesamten Bevölkerung, auch bei Jugendlichen. Neben der klassischen Psychotherapie und der psychopharmakologischen Therapie gibt es die Methode der transkraniellen Gleichstromstimulation. Für Erwachsene gibt es bereits Studien mit tDCS, die eine positive Wirkung bei Depressionen mit kaum Nebenwirkungen zeigen, für Jugendliche jedoch nicht.
Im Rahmen dieser Studie möchten wir ermitteln, ob die Gleichstromstimulation bei der Behandlung von Depression bei Jugendlichen hilfreich sein kann. Diese Studie richtet sich an (teil-) stationäre Patient:innen mit Depressionen zwischen 14 und 18 Jahren. Die Studie wird unter Leitung der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie im Evangelischen Klinikum Bethel durchgeführt.
Ansprechpartnerin:
Sophie Beer
E-Mail: sophie.beer@lwl.org
Telefon: 02381 893 8252
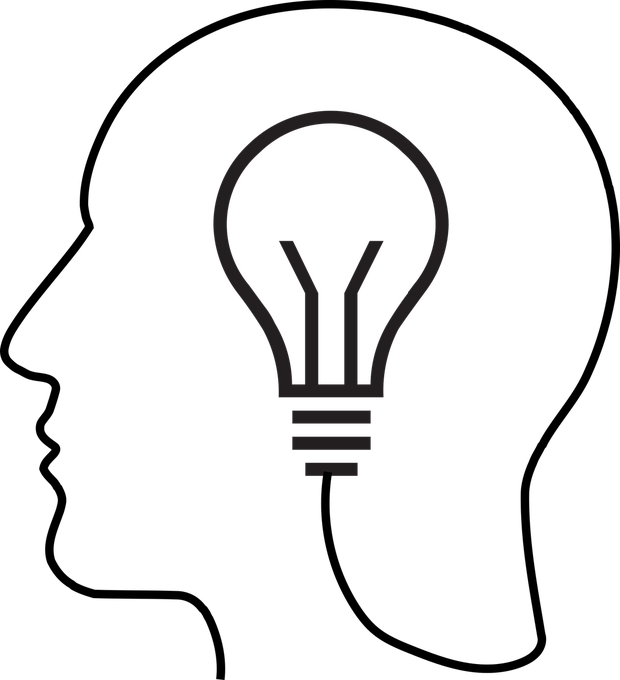
VISION-Studie
In der VISION-Studie möchten wir die Zusammenhänge zwischen Eigenschaften einer Person, Gefühlen (z.B. Wut) und sozialem Verhalten näher erforschen. Das Ziel dabei ist, die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Störungen des Sozialverhaltens zu verbessern.
Aus früheren Untersuchungen wissen wir bereits, dass Eigenschaften einer Person und Gefühle, die wir in einem bestimmten Moment haben, beeinflussen, wie wir andere Menschen wahrnehmen und auf sie reagieren. Es ist jedoch noch unklar, wie genau sich Kinder und Jugendliche mit Problemen im Umgang mit anderen Menschen von den Gefühlen der anderen Menschen beeinflussen lassen. Diese Zusammenhänge möchten wir in der virtuellen Realität genauer überprüfen.
Diese Studie richtet sich an Jungen zwischen zehn und 14 Jahren, die sich aufgrund einer externalisierenden Erkrankung in stationärer Behandlung befinden. Die Studie wird in Kooperation mit der Radboud Universität Nimwegen durchgeführt.
Für diese Studie suchen wir zudem Jungen im Alter zwischen zehn und 14 Jahren, ohne psychische Auffälligkeiten.
Wenn Dein Interesse geweckt ist, kontaktiere uns!
Ansprechpartnerin:
Laura Derks
E-Mail: laura.derks@lwl.org
Telefon: 02381 893 8252

ESCAlife-Studie: Wirksamkeit von ADHS-Therapien
In der ESCAlife-Studie untersuchen wir die Wirksamkeit verschiedener ADHS-Therapien bei Kindern und Jugendlichen zwischen drei und 17 Jahren. Dabei richtet sich die Therapie nach der aktuellen Symptomatik und passt sich so der jeweiligen Lebenslage des Patienten und seiner Familie an.
Behandlungsprogramme:
Im Rahmen der ESCAlife-Studie an der LWL-Universitätsklinik Hamm bieten wir unterschiedliche Behandlungsprogramme für Kinder und Jugendliche mit ADHS an.

PRISMA – Scham, Schuld und Stolz bei Jugendlichen
PRISMA war eine Studie, die den Einfluss von Scham auf depressive Symptome bei Jugendlichen untersucht hat. In der PRISMA-Studie wurde untersucht, welchen Einfluss die Neigung zu Scham auf zwischenmenschliche Beziehungen und Fehlerüberwachung hat. Außerdem wurde angeschaut, ob Mobbingerfahrungen einen Einfluss auf Scham haben. Im Erwachsenenbereich ist bereits bekannt, dass Scham einen enormen Einfluss auf depressive Symptome hat. Bislang fehlen Ergebnisse bei Jugendlichen mit Depressionen. PRISMA hat versucht, diese Lücke zu schließen. Die Studie wurde finanziell durch die Robert-Enke-Stiftung unterstützt.
Depressive Patient:innen und gesunde Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren haben an der Studie teilgenommen. Es wurden Daten von insgesamt 124 Jugendlichen erhoben. Insgesamt waren die Jugendlichen fast zwei Stunden mit der Durchführung an der Studie beschäftigt. Sie füllten Fragebögen aus und machten zwei Aufgaben am Computer. In der einen Aufgabe sollten sie eine bestimmte Maustaste drücken, je nachdem, welche Buchstaben auf dem Bildschirm erschienen. Sie bekamen Feedback für richtige und falsche Antworten von einem:einer Mitspieler:in. In der zweiten Aufgaben teilte ein:e Mitspieler:in 10€ auf und die Teilnehmer:innen konnten sich entscheiden, ob sie das Angebot annehmen oder ablehnen wollen. Während der Computeraufgabe wurden die Gehirnaktivitäten der Teilnehmer:innen mit einem EEG gemessen.
Wir fanden heraus, dass die Jugendlichen, die in ihrer Kindheit und Jugend Mobbingerfahrungen gemacht haben, eher zu Scham neigen und dass diese Schamneigung zu depressiven Symptomen beiträgt. Wir fanden aber auch heraus, was gegen die negativen Auswirkungen von Mobbing hilft: Wer selbstbezogene Freundlichkeit zeigt, das heißt, wer geduldig und liebevoll mit sich umgeht, der ist besser vor depressiven Symptomen und Scham geschützt, auch wenn er Mobbing erfahren hat.
Die Aufgaben am Computer zeigten, dass die Jugendlichen, die berichteten, zu Scham zu neigen, unfaire Angebote ihrer Mitspieler:innen eher ablehnten. Wenn ihnen also von den 10€, die die Mitspieler:innen aufteilen sollten, nur 3€ oder weniger angeboten wurden, wollten sie lieber gar kein Geld als unfair behandelt zu werden. Jugendliche, die eher nicht zu Scham neigen, nahmen auch die unfairen Angebote an. Die Gehirnaktivität unterschied sich auch zwischen den Jugendlichen mit und ohne Neigung zu Scham: zu Scham neigende Jugendliche beobachteten ihre Fehler genauer. Wir vermuten, dass sie damit versuchen, weniger Fehler zu machen, die dann zu einem Schamgefühl führen. Da Scham ein sehr unangenehmes und schmerzhaftes Gefühl ist, ließe sich das gut verstehen.
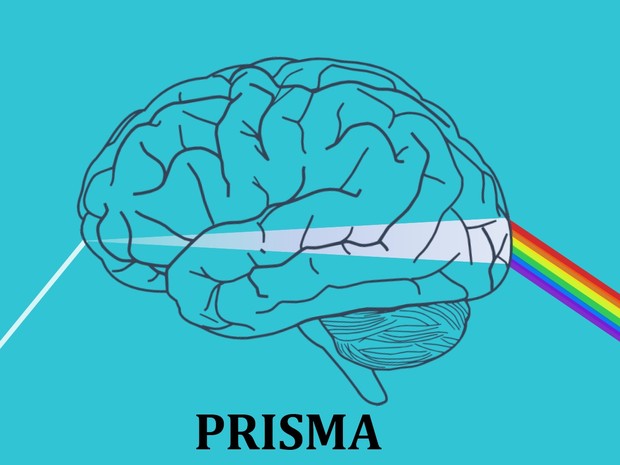
IMAC – Mind
„Achtsamkeitsbasierte Gruppentherapie bei Jugendlichen mit Suchthintergrund im stationären Setting“. Runter vom Autopiloten, sich selbst besser wahrnehmen.
Um die Behandlung von Suchterkrankungen bei Jugendlichen zu verbessern, wurde in dieser Studie die Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierter Gruppentherapie bei Jugendlichen mit Suchthintergrund im stationären Setting untersucht. Sowohl in der Arbeit mit anderen psychiatrischen Störungen als auch mit Erwachsenen im Suchtbereich ist die Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter Anwendungen bereits wissenschaftlich belegt. Erste Studien mit Jugendlichen mit Suchthintergrund im englischsprachigen Raum weisen auf eine gute Wirksamkeit und mögliche Ergänzungsmöglichkeit der gängigen therapeutischen Praktiken hin. Jedoch fehlten bisher Therapiemanuale und Studien, die die Wirksamkeit im deutschsprachigen Raum belegen.
Diese Forschungslücke wollte dieses vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt schließen. Dazu besuchten 41 stationär behandelte Jugendliche mit einer Abhängigkeitserkrankung zusätzlich zur Regelbehandlung über vier Wochen regelmäßige Gruppenpsychotherapiesitzungen und anschließende Stabilisierungssitzungen. Die Studie fand in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) statt.
Nach jeder Gruppenstunde wurden die Teilnehmer:innen und die Therapeutinnen bezüglich unterschiedlicher Punkte gefragt, wie sie die Sitzungen bewerten würden. Dabei erzielte die achtsamkeitsbasierte Gruppentherapie "Mind It!" durchschnittliche bis gute Bewertungen. Die Teilnehmer:innen beschrieben, dass sie die entspannende Wirkung von Meditationsübungen angenehm fanden. Andererseits empfanden sie das Ausrichten der Aufmerksamkeit auf unangenehme Gedanken und Gefühle manchmal als unangenehm. Sie berichteten also von positiven aber auch von herausfordernden Erfahrungen. Den Therapeutinnen ging es ähnlich.
Diese Rückmeldungen sind sehr wertvoll, da sie sowohl bei einer Anpassung der Gruppeninhalte als auch bei einem möglichen erneuten Angebot der Gruppe berücksichtigt werden können. Diese ersten Ergebnisse wurden bereits veröffentlichen (Baldus et al. (2022), SUCHT, 68 (1), 29–39). Weitere Veröffentlichungen sind in Arbeit.

DeLight - Wirksamkeit von Lichttherapie
DeLight ist eine „Randomisiert-kontrollierte Studie zur Lichttherapie bei depressiven Jugendlichen im stationären Setting“
Mehr Licht! Um die Behandlung von depressiven Erkrankungen zu verbessern, wird in dieser Studie die Wirksamkeit von Lichttherapie bei depressiven stationären Jugendlichen untersucht. Im Erwachsenenbereich ist Lichttherapie als zusätzliches Behandlungselement bereits etabliert. Erste Studien im Jugendalter deuten vor allem auf eine Verbesserung des Schlafes hin. Jedoch fehlen größere randomisiert-kontrollierte Studien, um allgemeingültige Aussagen zu treffen. Diese Forschungslücke möchte dieses vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt schließen. Dazu werden etwa 224 stationär behandelte Jugendliche mit einer Depression zusätzlich zur Regelbehandlung über vier Wochen morgendliche Lichttherapie (mit einer Lichtintensität von 10.000 lux) mit Hilfe von Lichtbrillen -sog. Luminetten - erhalten.
Die Studie wird in Kooperation mit den Unikliniken Neuruppin, Ulm und dem UKE in Hamburg durchgeführt.

SWAN-Studie
In unserer neuen Studie zur Wahrnehmung des Körpers (SWAN) möchten wir die Zusammenhänge zwischen psychischen Erkrankungen und Körperwahrnehmung erforschen. Jugendliche werden in den Medien, in sozialen Netzwerken und im Freundeskreis ständig mit dem heutigen Schönheitsideal konfrontiert. Häufig besteht großer sozialer Druck, diesem zu entsprechen. Daher sind viele Mädchen mit ihrem Körper unzufrieden. Diese Unzufriedenheit kann sich immer weiter verstärken und dazu führen, dass nur noch negative Aspekte des Körpers gesehen und er nicht mehr realistisch wahrgenommen wird. In der Folge kann der Selbstwert oder auch das Essverhalten beeinträchtigt sein.
Ob körperliche Unzufriedenheit auch bei Jugendlichen mit emotionalen Störungen, wie beispielsweise Depressionen, zu beobachten ist oder ob es Jugendlichen generell schwerfällt, ihren Körper realistisch einzuschätzen, wissen wir bislang noch nicht. Daher ist es wichtig, mehr über das Körperbild bei Jugendlichen zu erfahren und dabei verschiedene Faktoren wie eben Depressionen und Essstörungen, die einen Einfluss auf das Körperbild haben könnten, mit zu berücksichtigen. Die Ergebnisse dieser Studie helfen langfristig, die Behandlung depressiver Mädchen zu verbessern oder auch, gezielter Präventionsmaßnahmen durchzuführen.
Diese Studie richtet sich an Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren, die sich aufgrund einer depressiven Erkrankung in stationärer Behandlung befinden. Die Studie wird in Kooperation mit der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster durchgeführt.
Für diese Studie suchen wir zudem Mädchen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, ohne psychische Auffälligkeiten.
Wenn Dein Interesse geweckt ist, kontaktiere uns!
Ansprechpartnerin:
Neele Cammenga
E-Mail: Neele.Cammenga@lwl.org
Telefon: 02381 893 8252